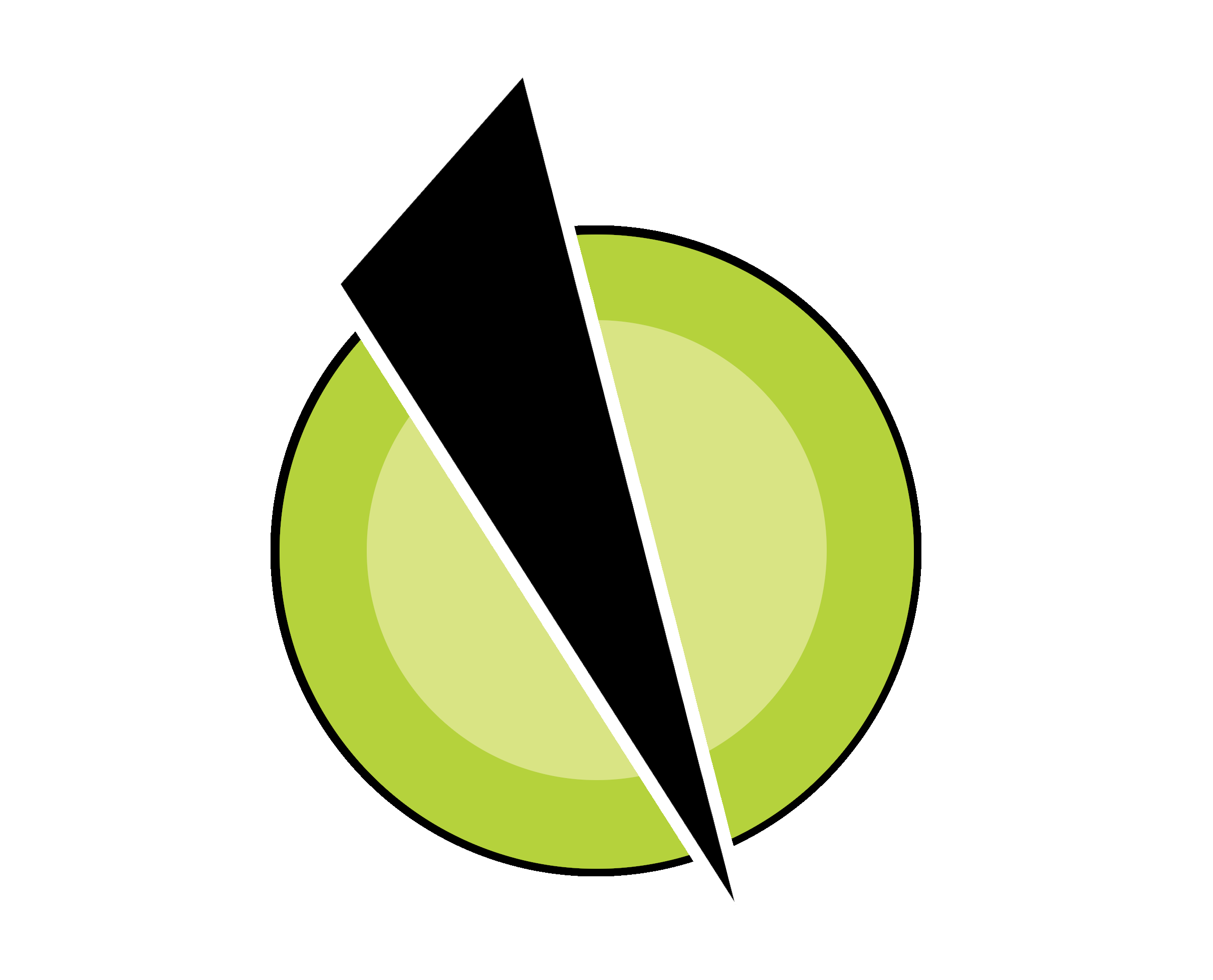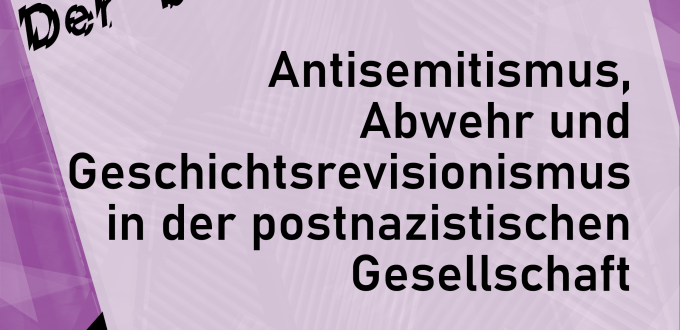Fast anderthalb Jahre sind vergangen seit dem 7. Oktober 2023, dem von der Hamas und Verbündeten verübten weltweit größten vernichtungsantisemitischen Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Überlebende des Massakers, sowie jetzt erst nach anderthalb Jahren aus der Gefangenschaft mit brutaler Folter und (sexualisierter) Gewalt befreite Geiseln, sowie Angehörige der Opfer sehen sich von der Weltgemeinschaft größtenteils nicht mit Empathie und Solidarität, sondern mit Verhärtung gegenüber ihrem Leiden und mit antisemitischen Anfeindungen konfrontiert.
Mit der Veranstaltungsreihe möchten wir über das Jahr verteilt einige Aspekte davon thematisieren, warum diese antisemitischen Weltdeutungen und Feindbilder so eine starke Anziehungskraft auf Menschen ausübt, unabhängig davon, ob diese sich mit rechten Ideologien anhängen, sich in der vermeintlichen ‘Mitte der Gesellschaft’ oder als ‘unpolitisch’ verorten, oder sich als links und emanzipatorisch verstehen.
Die weltweit aufgeheizten Debatten und Berichterstattungen, die antisemitischen Proteste und Boykottafurufe gegen Israelis sowie Jüdinnen und Juden sind seitdem nicht abgerissen. Antisemitische Schmierereien, Bedrohungen und Übergriffe sind seit dem 7. Oktober stark angestiegen. Für Jüdinnen und Juden ist diese Bedrohung im Alltag allgegenwärtig, und auch mit den Betroffenen solidarische Veranstaltungen zur Kritik an (israelbezogenem) Antisemitismus können oft nicht ohne Schutzmaßnahmen oder ohne Störungen und Gegenproteste stattfinden. Dabei stehen häufig die ansonsten unterschiedlichsten und unvereinbarsten politischen und ideologischen Lager zusammen: Linke Gruppierungen teilen islamistische Proganda oder laufen gemeinsam mit neurechten Akteuren und islamistischen Verbänden bei antisemitischen Demonstrationen mit, so etwa auch beim alljährlichen ‘AlQds-Tag’, der u.a. wieder in Frankfurt a.M. geplant ist.
Wie konnten sich – teils gezielt von der Hamas und anderen islamistischen Gruppen verbreitete – Fehlinformationen auf so fatale Weise wie ein Lauffeuer verbreiten? Wie spielen Empörungsabwehr bzw. Empathielosigkeit gegenüber Jüdinnen und Juden einerseits, Empörungsbereitschaft und affektiver Aktionismus andererseits als strukturelle Merkmale von Antisemitismus hierbei eine Rolle? Inwiefern kann auch bei linken, im Selbstverständnis emanzipatorischen Strukturen und Subjekten die kritische Reflexion und die Aufklärung über auch unbewusst reproduzierte antisemitische Stereotype versagen, weil die Verdrängungs- und Abwehrmechanismen hier einen blinden Fleck hinterlassen? Was ist so verlockend daran für linke Akteure, etwa Parolen wie ‘Free Gaza from German Guilt’ zu skandieren? Wie können Gruppen und Subjekte ihren (queer-)feministischen Anspruch damit vereinbaren, die mysogynen und homophoben Ideologien und die sexualisierte Gewalt des 7. Oktober zu verharmlosen? Warum scheitert die deutsche linke Bewegung kontinuierlich daran, sich mit jüdischen Organisationen und mit anderen emanzipatorischen Gruppen, etwa aus der iranischen Oppositionsbewegung, zu solidarisieren und zu vernetzen? Warum wird die Kritik an islamistischen antiemanzipatorischen Ideologien und Strukturen größtenteils aus linken Debatten ausgeklammert? Was verbirgt sich hinter geschichtsrevisionistischen Behauptungen wie denen, dass Israel ein ‘Kolonialstaat’ sei, oder mit den Kriegshandlungen im Nachgang ‘das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 21. Jahrhundert’ oder gar einen ‘Völkermord’ begangen habe? Und wie kann eine Reflexion auf die Fehler, welche linke Bewegungen und Theorien in der Vergangenheit gemacht haben, zu einer aktualisierten Kritik an antisemitischen Denkmustern und Verhaltensweisen beitragen?
Gerade in der Analyse der deutschen und deutschsprachigen Linken ist dabei die Besonderheit mitzudenken, dass diese ihre Positionen in einer postnazistischen Gesellschaft und Sprache formuliert. Eine verantwortungsbewußte Gesellschafts- und Antisemitismuskritik kann nicht umhin, die historischen Entstehungsbedingungen auch linker Kapitalismuskritik zu beachten. Die Veranstaltungsreihe wirft deshalb auch einen Blick auf Kontinuitäten und Umwandlungen antisemitischer Denkfiguren in linken Debatten im Postnazismus mit einem genaueren Augenmerk auf die Entwicklungen seit dem 7. Oktober 2023.
Bisher sind in der Reihe folgende Veranstaltungen geplant:
25.03.2025, Einlass 18:30 Uhr / Beginn 19 Uhr, Kreativfabrik Wiesbaden:
Heftdiskussion: What’s left? Antisemitismus und die Linke nach dem 7. Oktober
Heftpräsentation von der diskus-Redaktion
Bereits 1979 schrieb Moishe Postone in der diskus: »Die Linke machte einmal den Fehler anzunehmen, daß sie ein Monopol auf Antikapitalismus hätte; oder umgekehrt: daß alle Formen des Antikapitalismus zumindest potentiell fortschrittlich seien. Dieser Fehler war verhängnisvoll – nicht zuletzt für die Linke selbst.« Ergänzt man »Antikapitalismus« um andere linke »-ismen« wie Feminismus oder Antirassismus, stellt sich die Frage, wie die gegenwärtige Linke diesem »Verhängnis« heute entgehen kann: Was bleibt von linken Ideen und Bewegungen angesichts ihrer antisemitischen Verkehrung übrig? Was bedeutet »links« angesichts der zunehmenden Delegitimierung linker Selbstkritik?
Um diese Fragen geht es auch in der aktuellen Ausgabe der diskus (mit Texten u.a. von Merle Stöver, Tom Uhlig und Moritz Zeiler) die wir vorstellen und diskutieren wollen. Seit dem 7. Oktober stellen sie sich einmal mehr auch in Bezug auf den Antiimperialismus, um den es vor allem gehen wird. Im Text »Antiimperialistische Gespenster« widmen sich Felyx Feyerabend und Kris Teva seiner Geschichte in der radikalen Linken und fragen danach, wie sein Comeback in einer Verbindung mit postmodernen Argumentationsmustern funktioniert. Die »antiimperialistischen Gespenster« sammeln sich international unter dem Banner der Palästina-Solidarität. Während man internationale Solidarität mit den Opfern des 7. Oktober, mit Israel und mit Jüdinnen*Juden weltweit nahezu vergeblich sucht, sind es vor allem die Gegner*innen der Islamischen Republik Iran, die sich sowohl im In- als auch im Ausland klar gegen die globale antisemitische Internationale positionieren. Einen Blick auf die Debatten und Perspektiven in der Opposition gegen das Mullah-Regime werfen Matteo Alba und Bijan Razavi in ihrem Text. Bei der Veranstaltung stellen die Autoren ihre Texte vor, im Anschluss gibt es die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren.
Zum Heft: https://diskus.copyriot.com/whats-left
15.04.2025, Einlass 18:30 Uhr / Beginn 19 Uhr, Kreativfabrik Wiesbaden:
Zwischen Erinnerung und Erinnerungsabwehr: 1968 als Bezugspunkt der antisemitischen Mobilisierung nach dem 7. Oktober
Vortrag von Lennard Schmidt
Der 7. Oktober 2023 hat eine weltweite antisemitische Mobilisierung entfesselt. Besonders auffällig ist dabei, dass diese Mobilisierung nicht nur aus altbekannten antiisraelischen Milieus gespeist wird, sondern sich gerade durch die Aufkündigung vormals israelsolidarischer und antisemitismuskritischer Räume auszeichnet – ob in linken Bewegungen, an Universitäten oder in der Kulturszene. Ausdruck dieses Phänomens sind die Palästina-Camps, die vor dem Hintergrund einer zur Ideologie geronnenen postkolonialen Theorie und identitätspolitischer Erwägungen ein breites Spektrum gegen Israel mobilisieren – von radikalen Feminist:innen bis hin zu Islamisten.
Auffällig ist die starke Bezugnahme auf die 68er-Bewegung. Doch handelt es sich dabei nur um Protestfolklore – oder lassen sich ideologische Kontinuitäten feststellen? Und warum verteidigen Liberale und Konservative plötzlich die 68er, wenn es um deren Indienstnahme als antizionistische Studentenbewegung geht?
Lennard Schmidt analysiert, wie die 68er-Bewegung heute von unterschiedlichen Akteuren instrumentalisiert wird – und was das über ihr historisches Verhältnis zum Antisemitismus aussagt. Zwischen Erinnerung und Erinnerungsabwehr entsteht so ein Bild, das mit den gängigen Erzählungen über 1968 bricht.
tba (Nachholtermin), Kreativfabrik Wiesbaden
Empörungsbereitschaft und -abwehr nach dem 07. Oktober
Vortrag von Johanna Bach
Dass man die Funktionsweise und die Tragweite des Antisemitismus nicht verstehen kann, wenn man sich in dessen Analyse allein auf die kognitiven Vorurteilsstrukturen beschränkt, ist in der Forschung inzwischen weitestgehend anerkannt. Es wird darauf verwiesen, dass anschließend an Sartres Rede vom Antisemitismus als „Weltanschauung und Leidenschaft“, auch dessen emotionale Seite berücksichtigt werden müsse.
In diesem Kontext bisher wenig erforscht, ist die Rolle sogenannter „moralischer Gefühle“. Zu diesen zählt neben Schuld und Groll auch das Gefühl der Empörung, das in der Moralphilosophie als stellvertretendes Gefühl definiert wird. Was es für Opfer von Verbrechen bedeutet, wenn sich ihre Mitmenschen über das ihnen Angetane nicht empören, beschreiben u.a. Hannah Arendt, Primo Levi oder Jean Amery nach der Shoah eindrücklich. Und auch nach den antisemitischen Massakern der Hamas vom 7. Oktober 2023 beklagen Jüdinnen und Juden eine weit verbreitete emotionale Regungslosigkeit.
Gleichzeitig lässt sich nach dem 7. Oktober – gerade in linken Kreisen – eine enorme und geradezu intuitive Empörungsbereitschaft angesichts der israelischen Reaktion auf den Angriff der Hamas beobachten. Dabei geht es jedoch nicht immer um echte und notwendige Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Stattdessen dient Antisemitismus schon immer als identitätsstiftendes, kollektives Empörungs-Angebot, das moralische und emotionale Eindeutigkeit verspricht. Diese Gleichzeitigkeit von Empörungsverweigerung und Empörungsbereitschaft, die der Antisemitismus provoziert, gilt es auch angesichts aktueller Entwicklungen zu analysieren.