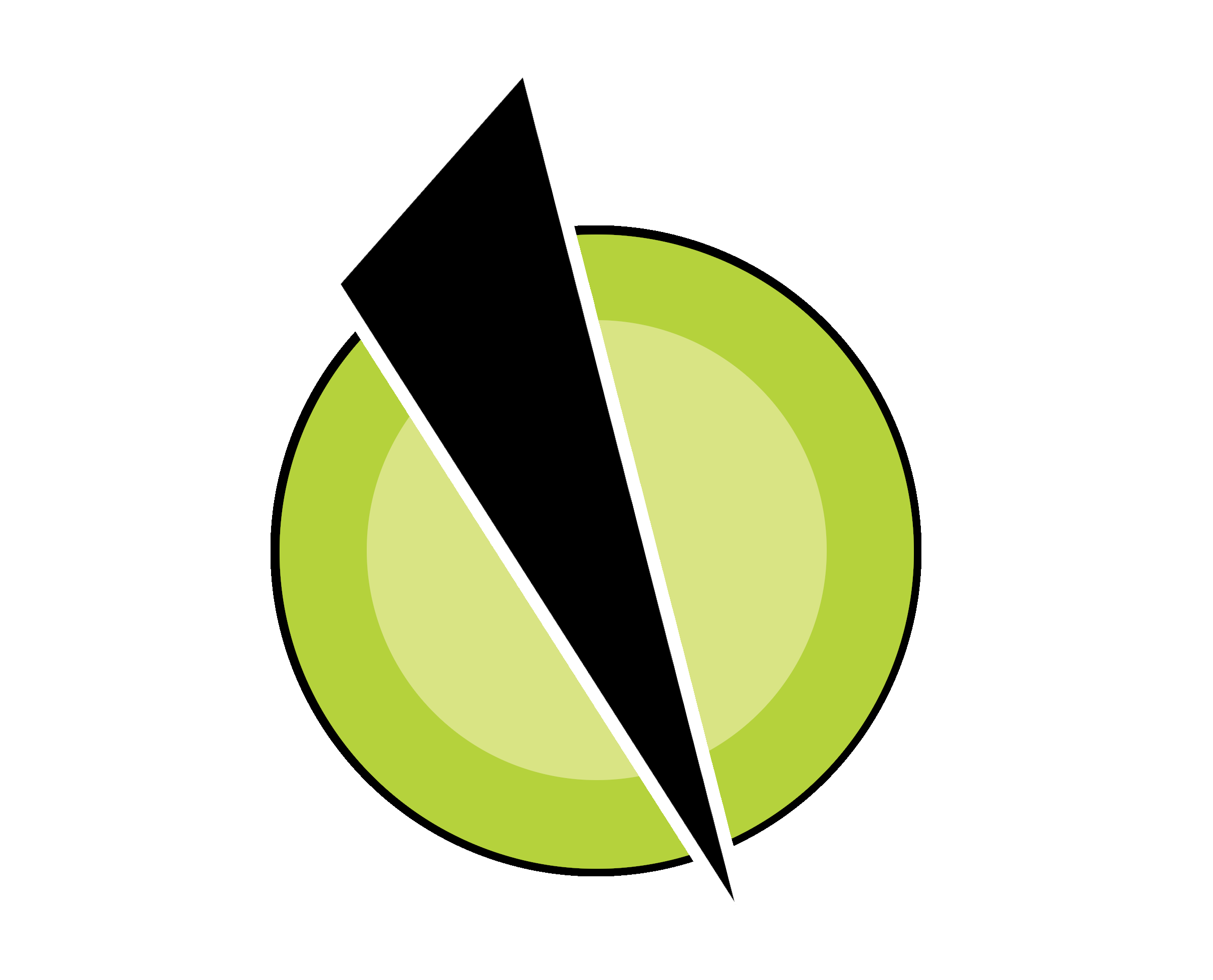Arbeit ist im Spätkapitalismus mehr als nur das halbe Leben. Mag die durchschnittliche Arbeitszeit in wohlhabenden Ländern auch (im historischen Vergleich) niedrig sein, bestimmt die Zurichtung durch und zur Arbeit uns alle im Alltag, bis in die Freizeit und persönliche Beziehungen hinein.
Zugleich werden sogar in diesen privilegierten Ländern die Arbeitsbedingungen zunehmend prekarisiert, mit abnehmenden sozialen Absicherungen oder etwa durch Zeitarbeitsfirmen – von den diesem zugrundeliegenden ausbeuterischen Zuständen in ärmeren Ländern und für migrantische Arbeiter*innen ganz zu schweigen.
Und auch Arbeitslosigkeit schützt vor dem Arbeitsfetisch nicht, im Gegenteil: Als das vermeintlich „faule Andere“ ziehen Arbeitslose oft den Hass der arbeitswütigen Gesellschaft auf sich, und sind zudem Schikanen wie der Teilnahme an häufig sinnlosen „Maßnahmen“, der Annahme von „zumutbaren“ Stellen oder der Überprüfung der Arbeitsfähigkeit ausgesetzt.
Von „Arbeit“ ist heutzutage in allen möglichen Kontexten die Rede – wir „arbeiten“ nicht nur für Lohn, sondern auch in Form unbezahlter „Carearbeit“, an unseren Körpern, Selbstbildern, Persönlichkeiten, Beziehungen, unserem Marktwert und unserem „Mindset“; und wir leisten darüber hinaus „politische Arbeit“ oder „Bildungsarbeit“.
Die neoliberale Bereitschaft zu Flexibilität, Mehrarbeit und Selbstausbeutung wird schon im Schulsystem als sogenannte „Kompetenz“ vermittelt und in der Arbeitswelt vorausgesetzt, ob bei „bullshitjobs“ (wie Marketing/Werbung/ Sachbearbeitung im Jobcenter) oder in einem vermeintlich „sinnstiftenden“ Beruf (im sozialen Bereich oder der „Weltverbesserung“ verpflichteten Jobs wie bei NGOs oder in der Bildungsarbeit). Die psychischen und gesundheitlichen Folgen unterliegen zwar den jeweils spezifischen Bedingungen, sind aber allumfassend – ob durch Über- oder Unterforderung, Knochenjobs oder Büroarbeit, cholerische Chefs oder „flache Hierarchien“, Burnout oder Langzeitatbeitlosigkeit.
Der Kapitalismus zwingt seit jeher Menschen zu Verkauf und Reproduktion der Arbeitskraft. Arbeit dringt dabei in alle Subjekte ein und bestimmt ihre „Identität“, ob sie sich diese selbst zuschreiben oder diese durch die Gesellschaft aufgezwungen bekommen. Allerdings gilt es für eine fundierte Kritik an kapitalistischen Arbeitsverhältnissen diese gerade in ihren jeweiligen spezifischen historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Blick zu nehmen.
Die Veranstaltungsreihe möchte in diesem Sinne noch einmal eine materialistische Kritik an dem „Fetisch Arbeit“ nachzeichnen und sich zugleich damit beschäftigen, welche Art von verkürzter Kapitalismuskritik selbst in eine solche Fetischisierung verfällt – oder gar in einen (strukturellen oder offenen) Antisemitismus.
Dabei soll der postnazistischen Besonderheit der Ideologie „deutscher Arbeit“ und der Geschichte von Zwangsarbeit und „Vernichtung durch Arbeit“ nachgegangen werden. In der Zwangsarbeit zeigt sich das antiemanzipatorische Potential von Arbeit am deutlichsten bzw. brutalsten. Durch die fehlende Aufarbeitung und Entnazifizierung bricht sich die NS-ideologische Vorstellung von Arbeit als verdrängte aber auch heute noch Bahn in deutschen Debatten und deutschem „Arbeitsethos“. In Deutschland wurde und wird Arbeit meist überhöht – der deutsche Arbeiter schafft an der Volksfront für die Heimat, und faul sind immer die Anderen.
Doch auch im Historischen Materialismus nach Marx gilt Arbeit als die Grundlage menschlicher Gesellschaft und als Bedingung des Mensch-Natur-Verhältnis. Dabei gingen viele Marxist*innen lange von einer kontinuierlich fortschreitenden Entwicklung eines Klassenbewusstseins aus und dachten, dass das Proletariat nur die Kontrolle über die Produktionsmitteln erkämpfen müsse, um den Kapitalismus in die befreite Gesellschaft zu überführen. Das revolutionäre Subjekt ‘Arbeiterklasse’ hat aber lange niemand mehr gesehen (außer altlinke Gespenster).
Mitunter wollen jedoch auch heutige feministische Kritikansätze die „Arbeiterklasse“ auf modernisierte Weise wieder vulgärmarxistisch beschwören und wiederholen so selbst die – schon längst als patriarchal durchschaute – Reduktion feministischer Kämpfe auf einen „Nebenwiderspruch“. Demgegenüber stehen andere, queerfeministische Positionen, die der neoliberalen Identitätsbildung und Selbstvermarktung strukturell entgegenkommen, oder etwa selbstbestimmte „Sex work“ pauschal als eine Form von emanzipatorischer selbständiger Arbeit betiteln. Dagegen wäre eine feministische Kritik an Arbeit zu setzen, die patriarchale Geschlechterverhältnisse und als „weiblich“ konnotierte Care- und Reproduktionsarbeit als notwendigen strukturellen Bestandteil kapitalistischer Logik rekonstruiert.
Jede Arbeit ist eine Zumutung.