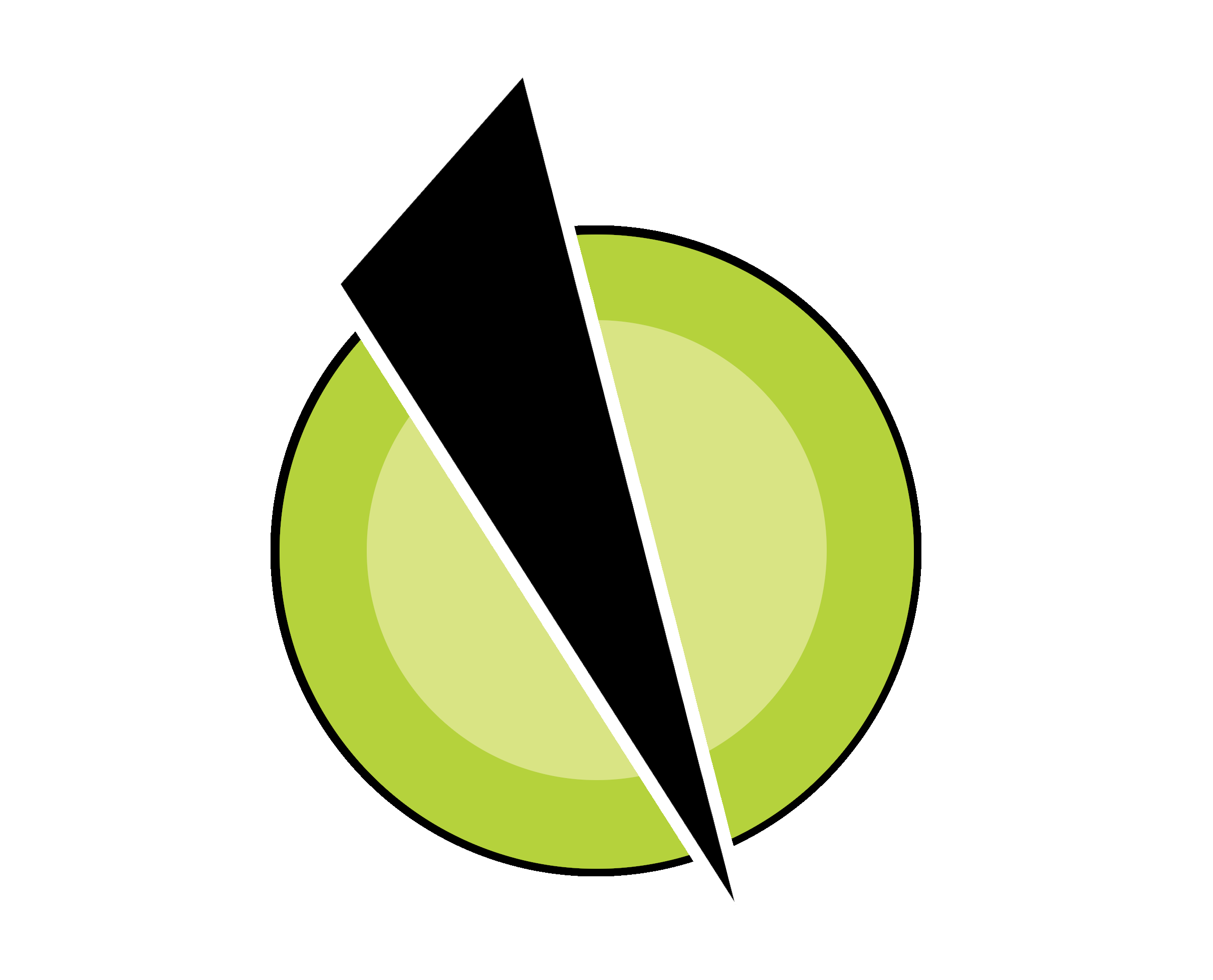Reflexionen über Subjektivität, Männlichkeit und psychische Gewalt in unserer Gruppe
KI:Wi und Sabot: Verstrickungen und Verstricktheit
Wenn wir uns als Kritische Intervention Wiesbaden (KI:Wi) zu den Geschehnissen um das Sabot und dessen notwendigem Ende positionieren, bedeutet dies auch eine Positionierung zu unserer eigenen Gruppenvergangenheit. In Wiesbaden werden KI:Wi und Sabot häufig als synonym betrachtet, was allerdings nie so war. Es stimmt jedoch, dass es Überschneidungen gab: so waren einige Mitglieder des Vereins auch teilweise bei KI:Wi involviert und andersherum. Nicht zuletzt deswegen konnten wir die Räume relativ autark z.B. für unser Plenum nutzen und zahlreiche Vorträge, Kneipenabende und Soli-Partys veranstalten.
Auch neben einzelnen Doppelmitgliedschaften war das Verhältnis von KI:Wi und Sabot ein wechselvolles. Zwischen phasenweiser produktiver Zusammenarbeit, über Vereinnahmung als politisches Feigenblatt im zuvorderst als „subkulturell“ gelabelten Raum bis hin zu Anfeindungen. So wurde uns ebenso vorgeworfen, diesen “subkulturellen” Raum zu politisieren, eine Agenda zu verfolgen, allein für Unordnung verantwortlich zu sein etc. Gemeinsam haben jedoch sowohl der Verein Sabot als auch wir als Gruppe, dass wir lange mit unserem Wirken hinter unserem Anspruch zurückgeblieben sind und damit nach außen wie nach innen großen Schaden sowohl angerichtet wie auch erlitten haben.
Wie in dem Statement der Betroffenen (darunter eben auch Mitglieder von KI:Wi) bereits nachzulesen ist, gab es im Sabot neben einigen strukturellen Problemen zusätzlich eine männliche Person, die sich durch manipulatives und einschüchterndes Verhalten sowie die Anhäufung bestimmter Ressourcen und Zugänge eine Vormachtstellung im Verein sichern und über lange Zeit erhalten konnte. Sowohl die manipulative Person als auch einige der Leidtragenden von Diskreditierung, Herabsetzung und psychischer Gewalt (insbesondere Gaslighting) waren gleichzeitig Teil von KI:Wi. Glücklicherweise kann gesagt werden, dass viele der von diesem Verhalten besonders betroffenen Frauen* immer noch elementarer Teil von KI:Wi sind.
Gaslighting
„Gaslighting basiert auf Manipulation der betroffenen Person, aber auch des direkten Umfelds dieser. Durch eine Vertrauensperson, häufig der*die Partner*in[,] wird der betroffenen Person die eigene Wahrnehmung systematisch und wiederholend abgesprochen und das Selbstwertgefühl zerstört. […] Auch dazu gehört, dem Opfer die Schuld an Konflikten zu geben, Worte im Mund umzudrehen, Fähigkeiten abzusprechen, sozial zu isolieren, und Freund*innenschaften beispielsweise so zu manipulieren, dass auch die Freund*innen der betroffenen Person nicht mehr vertrauen.“ (aus: Redebeitrag, Feministischer 8. März Lüneburg)
Der Begriff wurde geprägt von der Psychologin Dr. Robin Stern vom Yale Center of Emotional Intelligence. Sie fasst den erheblichen Schaden, den diese Form der Manipulation über längeren Zeitraum auf die Psyche ausübt, treffend zusammen: Gaslighting „make[s] you doubt your own perceptions, memory, or sense of reality“. (Dr. Robin Stern: The Gaslight Effect, 2007)
Er ist aber auch kein im engeren Sinne psychologischer Fachbegriff, also z.B. kein Begriff, der in Diagnosekriterien verwendet wird. Wir nutzen ihn also auch nicht, um Küchenpsychologie zu betreiben. Denn ‘Gaslighting’ beschreibt keine psychische Erkrankung, sondern eine Form von manipulativem Verhalten.
Mittlerweile wird der Begriff häufig und vermehrt auch in feministischen Kontexten verwendet. Das liegt auch daran, dass die zugrundeliegende Dynamik auf Ungleichheit basiert und häufig (genderspezifische) Stereotype genutzt werden. Allerdings wird der Begriff oft sehr ungenau verwendet und dadurch beliebig ausgeweitet. Von Gaslighting lässt sich erst sprechen, wenn das Verhalten strukturell und dauerhaft auftritt.
In unserem Fall beschränkte sich das Verhalten nicht auf eine Betroffene, sondern wurde systematisch auf die gesamte Gruppe ausgeweitet und zog sich über Jahre.
Frauen*
Wir verwenden die Selbstbezeichnung Frauen*, weil alle der betroffenen Autorinnen sich so verstehen. Weiterhin schließen wir uns damit an das politische Subjekt Frau und die damit verbundene Geschichte feministischer Kämpfe an. Wir wollen damit nicht die binäre Geschlechterordnung befürworten. Das * drückt für uns aus, dass wir komplexer sind als die uns von der Gesellschaft zugeschriebene Geschlechtsidentität. Gleichzeitig ist uns aber während der Aufarbeitung der Geschehnisse nochmal
deutlich bewusst geworden , wie sehr das Verhalten der beteiligten Personen durch die männliche und weibliche Sozialisation beeinflusst war. Wir wurden als Frauen* anders behandelt und bewertet, weswegen es uns wichtig ist, genau diese Verhältnisse auch so darzustellen.
Aus eben diesem Grund haben wir uns auch gegen die Verwendung von der Bezeichnung Männer* entschieden, da dies die Geschlechter- & Hierarchieverhältnisse verschleiern würde. Die Schreibweise “Männer” ohne Sternchen, die wir für die männlich sozialisierten Personen in der Gruppe verwenden,
zeigt an, dass Männer im Gegensatz zu nicht männlichen Personen im Patriarchat kein unterdrücktes politisches Subjekt sind. Uns ist bewusst, dass der männliche Teil der Autoren dieses Textes nicht selbstverständlich und bruchlos mit ihrer Männlichkeit übereinstimmen, aber durchaus davon geprägt sind. Zur Kritik an (linker) Männlichkeit und unserer Kritik an den (binären) Geschlechterverhältnissen
findet ihr weiteres im Text.
An dieser Stelle soll auch deutlich werden, dass die manipulative Person seit Jahren nicht mehr Teil unserer Gruppe ist. Dies geschah mehr oder weniger auf eigenen Wunsch. Heute gibt es keinerlei Beziehungen mehr zu dieser Person und dies ist auch im Sinne aller KI:Wi-Mitglieder, weil das Ausmaß der Manipulationen und ihre schädigende Wirkung auf die Gruppe, aber auch auf die einzelnen Mitglieder, so enorm – und enorm schambesetzt – war und den Meisten erst im Nachhinein bewusst geworden ist.
Die Betroffenen innerhalb von KI:Wi konnten mit ihrem unermüdlichen Drängen auf eine Aufarbeitung in der Gruppe erreichen, dass wir uns alle mittlerweile intensiv mit den damaligen Gruppenstrukturen, mit unsolidarischem oder unempathischen Verhalten der Gruppenmitglieder und dem schwer übersehbaren Zusammenhang mit gesellschaftlichen Geschlechterrollen auseinandergesetzt haben und dies weiterhin tun. Da wir der Überzeugung sind, dass eine progressive Praxis ehrlicher und ernsthafter Reflexion bedarf und Kämpfe nur gemeinsam geführt werden können, möchten wir diesen langwierigen und schwierigen Prozess auch nach außen hin sichtbar machen.
Derart interne Vorgehen öffentlich zu machen fällt und fiel uns nicht immer leicht, weder bei der Initialisierung des FreiraumBruch-Blogs, noch bei diesem Text. Nicht, weil wir Täter schützen wollen, sondern weil dabei eben auch viel, teilweise äußerst Intimes, zu Tage tritt. Wir sind aber überzeugt, dass das, was wir hier schildern, ein leider sehr häufiges Phänomen ist. Gegen etwaige Vorwürfe es sei unsolidarisch, so an die Öffentlichkeit zu gehen, wollen wir einwenden: gerade dies ist solidarisch – mit allen Betroffenen, Probleme innerhalb der Szene zu benennen und dadurch die Möglichkeit für Solidarisierung zu eröffnen. Wir hoffen, dass dieser Text Andere ermutigt, sich mit ähnlichen Erfahrungen in den eigenen Gruppen zu beschäftigen.
Namensnennungen
Wir haben uns aus guten Gründen dagegen entschieden, den Namen der Person zu nennen, die
in unserer Gruppe Schaden angerichtet hat. Erstens wollen wir die Leidtragenden in unserer
Gruppe schützen. Zweitens halten wir Outings für ein starkes politische Mittel, das nur
verhältnismäßig, strategisch und zielgerichtet angewendet werden sollte. Drittens geht es uns
mit diesem Text eben nicht darum, nur eine bestimmte Person als „Schuldigen“ auszumachen
und damit anderen die Möglichkeit zu geben, sich performativ abzugrenzen. Gerade im
Kontext des Sabot-Statements wurde mehrfach kritisiert, dass der “Schuldige” nicht benannt
wurde. Dabei lassen sich viele der beschriebenen Verhaltensweisen auch bei anderen
(männlichen) Personen in diesem Umfeld beobachten, wenn auch in weniger extremen Maße.
Wir alle haben in verschiedenem Ausmaß und auf unterschiedliche Weise dazu beigetragen,
dass die Probleme sich lange Zeit halten konnten, da sie nicht strukturell benannt und verändert
wurden. Uns geht es darum, zu reflektieren, wie sich solches Verhalten immer wieder in linken
Strukturen breitmachen kann. Dabei hoffen wir, dass Menschen diese Muster wiedererkennen
und auch in den eigenen Gruppen benennen und bekämpfen. Eine Fixierung auf „den einen
Schuldigen“ stünde diesem Ziel nur entgegen und würde diesem auch zu viel Macht
zusprechen.
Es liegt auf der Hand, dass der linke Anspruch eines Umgangs, der von Solidarität, Wertschätzung und Vertrauen bestimmt sein soll, in direktem Widerspruch zu unserer Sozialisation in einer Gesellschaft steht, die durch stetige Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen und Ungleichwertigkeitsideologien geprägt ist. Hierzu zählt eben auch die Reproduktion patriarchaler Verhältnisse samt der ihnen innewohnenden Hierarchisierungs- und Ausschlussmechanismen, Abwertungsdynamiken und der individuellen Verstrickung mit diesen.
Im Folgenden wollen wir offen legen, wie sich solche Zustände in einer sich selbst als emanzipatorisch verstehenden Gruppe über mehrere Jahre halten konnten und wie der Prozess der Aufarbeitung bis hierhin abgelaufen ist. Nicht von der Hand weisen lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Dynamik in der Gruppe und gesellschaftlichen Geschlechterrollen, den wir im letzten Abschnitt genauer beleuchten wollen. Hier geht es unter anderem darum, wie wirksam die Inszenierung männlicher Ideale und Mythen sowie deren weiblicher Negativbilder in linken Kontexten sein können. Dies zeigt sich beispielsweise auch an der konkreten Arbeitsteilung, wenn prestigereiche, kämpferische und strukturell bedeutsame Aufgaben immer wieder von männlich sozialisierten Personen vereinnahmt werden, während (emotionale) Care-Arbeit, auch im Gruppenkontext wie automatisch Frauen* zufällt, denen dies häufig noch als fehlende Radikalität oder Aktionsbereitschaft ausgelegt wird.
Warum wir keine „Machertypen“ brauchen
Wir haben uns seit der Gründung 2014 als herrschaftskritische, emanzipatorische und insbesondere auch als feministische Gruppe verstanden. Eine ganze Palette an Veranstaltungen und Aktionen trug unsere Positionen nach außen. Im Inneren der Gruppe aber hatte sich über Jahre hinweg eine destruktive, hierarchische, patriarchal geprägte Struktur etabliert, an deren Spitze ein selbsternannter „Macher“ stand. Diese oben bereits erwähnte Person, die gleichzeitig im Sabot federführend aktiv war, hatte KI:Wi mitgegründet und war bis 2018 Teil der Gruppe.
Narrativ des “Machers”
Ein entscheidender Mechanismus war das Narrativ des “Machers” – absichtlich nicht
gegendert -, den man angeblich in selbstorganisierten Strukturen „brauche“, damit überhaupt
etwas läuft. Das Macher-Narrativ wirkte lange Zeit in unserer Gruppe, und auch in anderen
Kontexten sehen wir es immer wieder. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese Figur
des “Machers” genauer zu betrachten und schließlich dafür zu argumentieren, dass wir sie
nicht brauchen.
Bei KI:Wi – im Gegensatz zum Sabot – gab es selbstredend nie eine Vorstandsstruktur. Alle Entscheidungen sollten im Konsensverfahren getroffen werden und wurden dies augenscheinlich auch. Trotzdem war meistens unausgesprochen klar, wer den Ton angab und auf wen alles zugeschnitten wurde. Auf diese Person wurde beispielsweise mit dem Plenum gewartet, er gab sich selbst das Wort, nahm sich die Redeleitung und nicht zuletzt war von seiner Stimmung vieles abhängig. Dies geschah manchmal, indem das in KI:Wi allen gleichermaßen zustehende Veto-Recht, das eigentlich für Aktionskonsens oder weitreichende Endscheidungen gedacht war, von dieser Person maßlos überstrapaziert und auf allerlei Kleinigkeiten angewandt wurde.
Indirekt sicherte sich der selbsternannte „Macher“ Macht durch Zugänge und Gruppenressourcen, wie den Mail-Server, und im Besonderen den Zugang zu den Sabot-Räumlichkeiten, von denen wir in gewisser Weise abhängig waren, wobei gerade diese Abhängigkeit von dieser Person entscheidend mitkonstruiert wurde. Zudem verfügte er über eine breitgestreute Vernetzung innerhalb Wiesbadens, aus welcher er Bedeutung und Rückhalt ableitete und die er auch als Druckmittel nutzte. Als Reaktion auf das Sabot-Statement betonten einige dieser Vernetzungskontakte, dass sie diesen Macker immer schon suspekt fanden, aber keine dieser Personen hatte sein Verhalten in den Jahren zuvor problematisiert oder deswegen die Vernetzung abgebrochen. Problematisch fanden das scheinbar alle nur im geschlossenen Kämmerlein oder am WG-Küchentisch.
Sein „Machertum“ untermauerte er mit seiner tatsächlichen und suggerierten Erfahrung in Politik und Aktivismus, die er in anderen Städten gemacht haben will. Dass er wohl stets wegen ähnlichen “Problemen” Gruppen und Städte gewechselt hat, können wir hier nur erwähnen. Seine Erfahrung betonte er insbesondere in Abgrenzung zu den vorwiegend wesentlich jüngeren oder weniger lange organisierten Genoss*innen. Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass die Erfahrungen des „Machers“ sich auf ganz bestimmte Aktionsformen und Themen beschränkte und diese Engführung politischer Arbeit für die Entwicklung der Gruppe schädlich war. Wenn seitens anderer Mitglieder versucht wurde, etwas an der Aufgabenverteilung und der Gruppenstruktur zu ändern, indem sie sich einbrachten und bestimmte Aufgaben übernehmen wollten, konnten diese sich seines Widerstands sicher sein. Sie standen, insofern ihnen überhaupt eine Möglichkeit des Mitwirkens eingeräumt wurde, unter genauster Beobachtung des „Machers“ und ihnen wurden kleinste Fehler vorgehalten oder hinter ihrem Rücken breitgetreten. Nach dem Austritt des „Machers“ konnten alle notwendigen Aufgaben neu verteilt werden. Zudem hat sich der inhaltliche Fokus der Gruppe stark gewandelt. Die regelmäßig von ihm aufgebaute Drohkulisse eines Zusammenbruchs im Falle seines Austritts bewahrheitete sich nicht. Tatsächlich war der Weggang eine Erleichterung und gab den nötigen Raum zur inhaltlichen Neuorientierung – auch wenn der eigentliche Reflexionsprozess erst viel später begonnen wurde, da die vordergründige Erleichterung einher ging mit Scham und Verdrängung des Geschehenen.
Aufgrund der von dieser Person ausgehenden Spannungen und des Unbehagens kam es häufiger zu heftigen Auseinandersetzungen im Plenum aber auch im vermeintlich Privaten, die viele Mitglieder mit der Zeit besser zu vermeiden wussten. Auch aus ganz pragmatischen Gründen wurde ihm oft in „kleineren“ Angelegenheiten sein Wille gelassen, obwohl alle anderen Gruppenmitglieder sich einig waren, weil ansonsten gar keine politische Arbeit möglich gewesen wäre: Alles hätte sich sonst um den jeweiligen für ihn im Fokus stehenden Konflikt gedreht, und er hätte mit trotzigem bis cholerischem Verhalten das Plenum gesprengt und darüber hinaus teilweise wochenlang Einzelne mit Nachrichten, Anrufen und Lügenkonstrukten bombardiert. Aufgrund solche Erfahrungen schluckten wir alle häufig Sachen runter, die uns diesen Stress einfach nicht wert waren. Rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, diese grundlegende Problematik anzugehen, anstatt die punktuellen Eskalationen zu vermeiden.
Alleine schon die Widersprüchlichkeit zwischen Anspruch und Realität der politischen Praxis zu thematisieren, führte innerhalb der Gruppe meist zu großen Eklats und Vorwürfen der Illoyalität. Er stilisierte “seine”, unsere Gruppe als heiligen Ort, der sich gegen äußere Feinde (staatliche Repression, Faschos, innerlinke Querelen, zeitweise das Sabot etc.) in einem immerwährenden Verteidigungskampf befände. Entsprechend wurden interne Kritiker*innen zu „inneren Störenfrieden“ oder sogar „Verräter*innen“ umgedeutet. Wer die Rolle des „Machers“ infrage stellte oder eigene Standpunkte durchsetzen wollte, wurde durch diesen mithilfe von Lügen und Intrigen delegitimiert. Mangelndes politisches Bewusstsein, angeblich gruppenschädigendes Verhalten oder zu wenig „Radikalität“ sind nur einige der Motive, die hierzu vom „Macher“ herangezogen wurden.
Einige von uns brachten gerade wegen ihrer grundsätzlichen Empathiefähigkeit zu lange noch Verständnis oder Mitleid für den „Macher“ auf, trotz seiner plötzlichen Wutausbrüche oder der Selbstinszenierung als „eigentliches Opfer“, und versuchten Konflikte möglichst schnell zu beschwichtigen. Sein Verhalten wurde lange als Ausdruck persönlicher Frustration und „eigener Probleme“ missinterpretiert und nicht als Strategie erkannt, mit der der „Macher“ seinen Willen durchsetzen wollte. Gerade dieses Verständnis für psychische und emotionale Schwierigkeiten von Individuen und auch das Bedürfnis, sich schützend vor Andere zu stellen, wenn diese ungerecht behandelt werden, ist aus einem solidarischen Miteinander nicht wegzudenken. Gleichzeitig macht es anfällig für Manipulation, wenn dies ständig als Rechtfertigung für problematisches Verhalten genutzt wird oder wenn eine Person diese Dynamik willentlich mit Inszenierungen, Gerüchten und Verzerrung von Tatsachen ausnutzt. Gerade besonders empathische und konfliktscheue Menschen wurden von ihm emotional erpresst, beispielsweise durch das gezielte „ins Vertrauen ziehen“ oder die stetige Behauptung andere könnten „mit der Wahrheit nicht umgehen”, da sie psychisch zu labil seien.
Eine tatsächliche, ernsthafte Kritik der Gruppenprozesse wurde stets als „Störung“ denn als notwendige Umsetzung des eigenen Anspruchs gesehen. So wurde die Gruppe für uns zu einem Raum, der zwar auf der politischen Ebene funktional erschien, persönlich aber Menschen zermürbte. Es gab als Gruppe mit ihm nur wenige Möglichkeiten des gemeinsamen Erlebens von Wirkmächtigkeit, von gegenseitiger Unterstützung oder Entwicklungsprozessen – in seiner Abwesenheit aber schon.
Die Manipulationen eines Einzelnen führten zu Misstrauen und Fraktionierung. Was eigentlich im Plenum hätte geklärt werden müssen, wurde immer weiter ins „Private“, bis zum Tabu, verdrängt. Die sowieso zehrende und belastende Antifa-“Arbeit” wurde so zu einer psychischen Mehrbelastung, die ihre eigentliche Tragkraft überstieg. Aufgaben wurden weniger nach Fähigkeiten und Bedürfnissen, nicht einmal besonders nach Notwendigkeiten, verteilt, sondern mehr durch ein eingeredetes schlechtes Gewissen angenommen. Dieses gruppeninterne Konstrukt führte dazu, dass Personen, die neu hinzukamen, bisweilen schnell wieder das Weite suchten oder trotz des Wunsches, sich zu engagieren, vor einer stärkeren Involviertheit zurückschreckten.
Die zugrundeliegenden Probleme, wie einseitige Aufgabenverteilung und hierarchische Strukturen, sind auch in linken und subkulturellen Kontexten ein allgegenwärtiges Problem, dem Gruppen nur durch Reflexion und gezieltes Handeln entgegenwirken können. Wenn aber gerade diese Auseinandersetzungen von Einzelnen bestimmt und vereinnahmt werden und dabei auch Manipulation im Spiel ist, kann echte Reflexion nicht gelingen, solange solche Personen noch Teil der Struktur sind.
Aufarbeiten, aber wie?
Anfang 2018 verließ der „Macher“ nahezu Hals über Kopf die Gruppe. Schwindende Anerkennung für seine „Leistungen“, ein immer schwieriger zu kontrollierendes Lügenkonstrukt sowie die wachsende Solidarisierung der Frauen* der Gruppe untereinander werden wohl Gründe gewesen sein. Nach dem Austritt des „Machers“ machte sich zuerst eine überwältigende Erleichterung breit. Die Gruppe hatte einige Verluste an Mitgliedern hinzunehmen, die im Laufe der vorangegangenen Wochen und Monate ausgetreten waren, und musste sich in vielerlei Hinsicht neu orientieren. Dabei wurde das Leid, was bereits durch die vielen Lügen und das gezielte gegeneinander ausspielen von Freund*innen bei Betroffenen entstanden waren, schlicht übergangen und verdrängt. Die Dynamik der Gruppe änderte sich rasch hin zu einem stärker von gegenseitiger Rücksichtnahme und Kommunikation auf Augenhöhe geprägten Miteinander. Eine Aufarbeitung des Geschehenen fand aber noch nicht statt.
Erst gut zwei Jahre später waren es Frauen* der Gruppe, die einen noch immerwährenden, längst überfälligen Reflexionsprozess auslösten, oder besser: einforderten. Vorausgegangen waren zahllose Gespräche unter den Leidtragenden, ohne die eine Aufarbeitung wahrscheinlich nie stattgefunden hätte. Aus der gegenseitigen Unterstützung der Frauen* untereinander entstand so der Versuch, mit unterschiedlichen Ansätzen eine gemeinsame Aufarbeitung zu bewerkstelligen, so schmerzhaft und belastend diese bisweilen auch ist. Einen großen Raum nahm und nimmt hier auch das komplizierte Wechselverhältnis zwischen KI:Wi und dem mittlerweile aufgelösten Sabot ein.
Der Reflexionsprozess in KI:Wi begann mit einer distanzierteren Auseinandersetzung mit Sexismus in der (radikalen) Linken, auch ausgelöst von Vorfällen wie zum Beispiel auf dem Festival „Monis Rache“ oder öffentliche Vorwürfe gegen „Szenegrößen“, die szeneweite Öffentlichkeit erlangt hatten. Darauf folgte ein Redebeitrag von uns zu linker Männlichkeit am Tag gegen patriarchale Gewalt. Im Anschluss daran versuchten wir uns mit Texten über linke Männlichkeit auf einem Gruppenwochenende dem Thema anzunähern. Wobei bei diesem seitens der am stärksten und direktesten Betroffenen zurecht kritisiert wurde, dass wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen könnten, als hätte es nichts mit unserer eigenen, ganz konkreten Gruppengeschichte zu tun. Während der Pandemie trafen wir uns dann zuerst alle paar Wochen online, um das Geschehene zu reflektieren. Schnell fiel uns jedoch eine Diskrepanz zwischen der Belastung und der Selbstoffenbarung der Leidtragenden und der restlichen Gruppenmitglieder auf. Solidarität mit Betroffenen sollte nicht nur das Abladen aller Verantwortung des Prozesses auf deren Schultern bedeuten, sondern gerade die Übernahme von Verantwortung seitens der Menschen, die die Situation mitgetragen haben. Deshalb entschlossen wir uns, dass jede Person in der Gruppe einen Text über ihre subjektive Wahrnehmung der Situation und eigene Rolle im Geschehen schreiben und bei den Treffen verlesen sollte. Dadurch sollten sich alle mit ihrer jeweiligen Position auseinandersetzen und mit der Frage, wie diese an der Aufrechterhaltung der destruktiven Gruppenstruktur mitgewirkt hat.
Faktisch waren es aber trotz allem die Betroffenen, auf denen der weitaus überwiegende Teil der Aufarbeitung und der emotionalen Arbeit lastete. Gerade die Zurückhaltung der meisten männlich sozialisierten Gruppenmitgliedern im Aufarbeitungsprozess mündete in der Forderung der Frauen* in der Gruppe, dass es eine spezifische Männerreflexionsrunde geben sollte. Dies geschah unter anderem, um dieser ungleichen Verteilung der emotionalen und organisatorischen Arbeit rund um den Reflexionsprozess entgegen zu wirken, die Frauen* für eine Zeit von der emotionalen und psychischen Belastung der ständigen Konfrontation mit diesem Thema zu entlasten, und die Männer zur Verantwortungsübernahme zu bewegen. Nachdem diese Männerreflexionsrunde zuerst relativ planlos war, erhielt sie später die Aufgabe, Grundzüge dieses Gruppenstatements zu verfassen und darin ihre besondere Verstrickung als männlich Sozialisierte mitzudenken. Einige dieser Überlegungen finden sich hier wieder. Auch wenn der Versuch einer seperaten Männerreflexionsrunde scheiterte und in Absprache mit den Frauen* abgebrochen wurde, dauert der Reflexionsprozess an.
Geschlecht und Macht im vorgeblich „herrschaftsfreien Raum“
Unbestritten handelt es sich bei dem Geschlechterverhältnis um keine natürliche Ordnung, sondern um eine gesellschaftliche. Das heißt, es geht nicht einfach um die Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht und erst recht nicht um die subjektive Identifikation mit einem sozialen Geschlecht, sondern um die strukturelle Geschlechterordnung.
Diese hat eine spezifische Geschichte und ganz konkrete materialistische Auswirkungen, die sich historisch an der Arbeitsteilung und damit verbundenen Normen und Gesetzen erkennen lässt. Abtreibungsrechte sind hier ein besonders eindrückliches Beispiel. Aufgrund ihrer strukturellen Bedeutung für die kapitalistische und patriarchale Gesellschaft wird diese Geschlechterordnung in jeder Erziehung gewaltsam in die Individuen eingeschrieben. Die dualistische Unterscheidung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit ist eine Folge dieser schmerzhaften Abspaltung aller Anteile in den Individuen, die mit der jeweiligen gesellschaftlichen Rolle in Konflikt geraten.
Die individuelle Unterwerfung unter eine binäre und heterosexuelle Geschlechterordnung ist eine Reaktion auf deren gesellschaftliche Übermacht, der letztlich kein Individuum vollends entrinnen kann. Dennoch bestimmt dieses Zwangssystem die Individuen nie ganz und es entstehen immer wieder Konflikte und Brüche in dem Verhältnis zwischen dem Individuum und seiner Rolle, die dann jedoch häufig durch noch aggressivere Abspaltung bereinigt werden.
Obwohl beide gesellschaftlichen Geschlechterrollen Abspaltung verlangen, ist in einer patriarchalen Gesellschaft das männliche Subjekt der Richtwert und das Ideal und Weiblichkeit besteht nur als Negativfolie und als Projektionsfläche für das Abgespaltene. Ein weibliches, politisches Subjekt kann sich deshalb nur durch das Bewusstsein über diese Unterdrückung und im gemeinsamen Kampf gegen diese entwickeln. Historisch kann dies an den Kämpfen von Frauen* sowie homo- und bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen und queeren Menschen nachvollzogen werden, und an den dort verhandelten Fragen danach, wie viel Anpassung und Abspaltung die gesellschaftliche Gleichwertigkeit mit dem männlichen Subjekt eigentlich wert ist. Männlichkeit als Ideal ist Teil der patriarchalen Erbschaft und symbolisiert alle gesellschaftlich erwünschten Eigenschaften, wie Rationalität, Stärke, Härte, Eigenständigkeit und Autorität.
So ist es kein Zufall, dass es sich bei dem „Macher“ um eine männliche Person handelte. Der „Macher“-Mythos, der sich so lange in und außerhalb der Gruppe durchsetzen konnte, knüpft ganz deutlich an männliche Identität, Sozialisation und Mythos an; so auch die erwähnte Engführung von politischer Arbeit auf einige aktionistische Bereiche, die als einzige wirklich von Bedeutung seien.
Von den Auswirkungen der destruktiven Gruppendynamik und von der Willkür des „Machers“ waren nicht alle Gruppenmitglieder gleichermaßen betroffen, obwohl nicht nur Frauen* unter der Situation gelitten haben. Wenn Männer sich einfügten, konnten sie als Männer Anerkennung bekommen. Lob für kampfsportlerische Fähigkeiten, für vermeintliche Radikalität, für den „politischen Durchblick“ oder, ironischerweise, für feministisches Verhalten, wurde ihnen selektiv vonseiten des „Machers“ zu Teil. Trotzdem waren auch sie nicht vor Wutausbrüchen oder Intrigen sicher.
Es kann jedoch klar gesagt werden, dass Frauen* viel stärker und rigider von Abwertung bis hin zu psychischer Gewalt betroffen waren. Ihnen wurden schon oft von vornherein Fähigkeiten oder wahlweise die allgemeine Zurechnungsfähigkeit abgesprochen. Sie wurden gezielt gegeneinander ausgespielt. Sie waren immer wieder Ziel von Lügen und offenen Hasstiraden. Offensichtlich gibt es auch hier einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Rollenbildern und dem Fakt, dass eine solche Darstellung von Frauen* als instabil, irrational, nicht vertrauenswürdig oder schlicht “hysterisch”, selten ausreichend hinterfragt wurden. Auch die Bagatellisierung von psychischer Gewalt als „persönlichen“ Konflikt, zeigt, dass die Trennung zwischen Privatem und Politischem immer wieder patriarchalen Strukturen und sexistischen Verhaltensweisen als Deckmantel dient.
Wenn die Männer nun aber in dieser privilegierten Position waren, warum haben sie dann nichts verändert? Das Spiel aus Macht, Einschüchterung, Lüge, aber auch Lob und Schmeicheleien, knüpfte auch hier an Grundmuster von Männlichkeit an. Daraus auszubrechen würde bedeuten, sich grundsätzlich mit der Sozialisation als Mann auseinander zu setzten. Verschiedene Identitätskonstruktionen, das Selbstbild als „linker“, „guter“ Mann, hätten aufgegeben werden müssen, und die Argumente, mit der das patriarchale Verhalten, wenn es doch mal auffiel, übertüncht wurde, wären hinfällig geworden. Genau das wäre aber notwendig gewesen, um dem eigenen Anspruch auch nur nahe zu kommen.
Im Gesamtgefüge der Gruppe waren es in der Regel Männer, die sich so viel eher der Komplizenschaft zur Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen hingegeben haben, eben trotz ihres feministischen Selbstanspruchs und ihres Selbstbildes als linke Männer. Dieser Anspruch wurde eher in zwischenmenschliche Bereiche außerhalb der Gruppe verlagert. In diesem Kontext wurde durchaus Support und emotionale Auffangarbeit geleistet. Doch anstatt eines solidarischen und offenen Umgangs miteinander stand die Bestandswahrung im Vordergrund: statt Haltung zu beweisen, die eigene Verstrickung zu reflektieren und in konkretes Handeln zu übersetzen, förderten sie durch ihr opportunistisches (Nicht-)Handeln die Aufrechterhaltung der sexistischen Gruppenstruktur.
Daneben gab es auch Frauen* und Männer, die die Konflikte und Auseinandersetzung zeitweise derart unangenehm fanden, dass sie diese komplett vermieden und sich dadurch in situative Apathie drängen ließen, gerade wenn es eigentlich an der Zeit war, einzugreifen, weil Andere bereits an ihrer Belastungsgrenze angekommen waren.
Diese erlernte Passivität ließ sich wiederum in dem Aufarbeitungsprozess vorrangig bei Männern beobachten. Während für viele der Frauen*, die dieses Vermeidungsverhalten vorher an den Tag legten, das Bekanntwerden des Ausmaßes der Manipulation, aber auch des entstandenen Leids, ein Umdenken bewirkte, war den meisten Männern die Beschäftigung mit der Gruppenvergangenheit weiterhin zu unangenehm. Diese sprachen das Thema weder von sich aus an, noch beteiligten sie sich, mit wenigen Ausnahmen, in gleicher Weise an den Reflexionstreffen. Wegen dieser Schieflage gab es im Laufe des Prozesses eine kritische Auseinandersetzung unter anderem mit Konzepten Kritischer Männlichkeit und Allyship. Kim Posster liefert hier einen guten Abriss über die Probleme kritischer Männlichkeit.
Die Problematik der Verschleierung patriarchaler Strukturen durch Identitätskonstrukte „linker“, „feministischer“ und „kritischer“ Männlichkeit wurde bereits angesprochen. Dagegen wäre eine Männlichkeitskritik zu setzen, die männliches Verhalten nicht durch feministische Vokabellehre und um sich kreisende Selbstbeleuchtung von Männern überdeckt, sondern dieses immer wieder analysiert und aufdeckt. In diesem Zusammengang haben wir uns mit dem Beispiel von Männergruppen seit den 1970ern beschäftigt, bei denen die Selbstreflexion oft in einer Selbstrechtfertigung stecken blieb. Ein Zusammendenken des eigenen psychischen Erlebens von Männlichkeit mit gesellschaftlichen Strukturen fand dabei nur oberflächlich statt. Obwohl wir diese Kritik nachvollziehen können, haben wir uns trotzdem – ergänzend bzw. parallel zur gemeinsamen Gruppenreflexion – für eine gesonderte Männerreflexionsrunde entschieden, allein um die Frauen von dem Thema zu entlasten. Allerdings sollte der Auftrag an die Männergruppe, das Gruppenstatement vorzubereiten, diese dazu ermutigen, die Zusammenhänge selbst zu analysieren, sich mit der eigenen Rolle zu beschäftigen und eine eigene Haltung zu entwickeln.
Mit den Worten „ich will nicht nur Allies“ brachte eine Frau* die Frustration mit der erlernten Passivität von Männern bei feministischen Themen und mit einer als „der Betroffenperspektive Zuhören“ getarnten Abwehr von Verantwortung, zulasten der Leidtragenden, zum Ausdruck. Bei aller Angst, etwas falsch zu machen, ist es im Sinne einer politischen Subjektwerdung notwendig, auch Standpunkte zu Themen zu entwickeln, von denen man nicht persönlich betroffen ist. Freilich ist ein Nachempfinden der Erfahrung von Betroffenen nicht möglich, auch weil diese sehr unterschiedlich sein kann. Gerade wenn diese jahrelang systematisch manipuliert wurden und durch Gaslighting in eine Situation gebracht wurden, in der sie ihrer eigenen Erinnerung, ihrer eigenen Wahrnehmung und Einschätzung der Realität nicht mehr trauen können, wäre es absurd, die „Betroffenenperspektive“ als subjektive zugleich als allgemeingültige „Wahrheit“ zu verstehen. Unserer Erfahrung nach war es in dieser Situation weitaus hilfreicher, auch die Perspektiven, Erinnerungen und Darstellungen der Anderen miteinzubeziehen und gemeinsam zu diskutieren, um das Ausmaß der nachhaltigen Verunsicherung und Erschütterung abzumindern. Allein zu hören, dass andere die Probleme auch wahrgenommen haben, half schon dabei, sich selbst nicht mehr „verrückt“ zu fühlen. Nicht unmöglich, wenn auch nicht einfach, ist aber ein analytisches Nachvollziehen der strukturellen Gegebenheiten und die Entwicklung einer Kritik an diesen. Noch schwieriger, aber auch möglich, ist die Übernahme von Verantwortung und das Ziehen praktischer Konsequenzen aus dieser Kritik.
Besser scheitern
Der Reflexionsprozess kann als erster notwendiger Schritt betrachtet werden, bleibt aber ohne konkrete praktische Konsequenzen unvollständig. Hier befinden wir uns selbst noch in einem Prozess des Ausprobierens. Beispielsweise haben wir, auch im Zusammenhang mit den Onlineplena während der Pandemie und damit einhergehendem Motivationsverlust und sozialer Distanz, „Befindlichkeitsrunden“ zu Beginn jedes Plenums eingeführt, mit der Hoffnung, dass hier Konflikte und Probleme direkt Raum finden könnten. Allerdings hatte es sich doch eher als Werkzeug bewährt, um alltägliche Kapazitäten, Interessen und Motivation der einzelnen Mitglieder zusammenzubringen, während für Konflikte und schwierige Themen eher gesonderte Strukturen geschaffen werden mussten. Unter anderem hierfür haben wir nun Sonderplena etabliert, bei denen wir hauptsächlich über ein bestimmtes Thema sprechen und sonst nur das nötigste Tagesgeschehen abhandeln. Ein Problem hierbei ist jedoch, dass zu spezifischen Terminen selten alle anwesend sein können.
Diese Herausforderungen von Engagement neben der Lohnarbeit spielt auch eine Rolle bei unserem Vorhaben, verstärkt Skillsharing-Strukturen zu schaffen, damit sich ungleiche Arbeitsteilung gar nicht erst entwickeln kann. Dies stößt sicher auch an Grenzen der persönlichen Präferenz, weil nicht jede*r jede Aufgabe übernehmen möchten. Trotzdem ist es wichtig, dass alle zumindest eine Vorstellung von jedem Aufgabenbereich haben und grundsätzlich über den Umfang informiert sind sowie über Grundlagenwissen verfügen. So kann nicht nur Gatekeeping, sondern auch die unbeabsichtigte Überlastung einzelner Mitglieder vermieden werden.
Die wichtigste Konsequenz aus dem Reflexionsprozess ist aber an diesem Punkt, dass Konflikte erst einmal grundsätzlich nicht als unangenehme Störung, sondern als notwendige Auseinandersetzung mit dem Potenzial einer Verbesserung verstanden werden. Ein offener Umgang mit- und untereinander ist dafür unerlässlich. Die Frage nach Anspruch und Wirklichkeit ist zu einem uns stetig begleitenden Faktor in unserer politischen Arbeit und unserem sozialen Miteinander in der Gruppe geworden, auch wenn dies oft anstrengend und unangenehm sein kann.
Die anhaltende Aufarbeitung und die Schaffung eines Kommunikationsumfeldes innerhalb der Gruppe hat einige Fortschritte gemacht und bewirkt. Wir sind uns über die Notwendigkeit der steten Reflexion auf sich verfestigende Rollenzuschreibungen und Hierarchien sowie auf die Reproduktion patriarchaler Verhältnisse, auch unter sich als „links“ verstehenden Subjekten, bewusst. Ebenso wissen wir aber auch: Ein Ausbruch aus der gesellschaftlichen Totalität, die eben auch eine patriarchale ist, kann unter den bestehenden Vorzeichen nicht gelingen. Die Möglichkeit des Andersseins möchten wir aber nicht vorzeitig beerdigen. Der Reflexionsprozess ist somit bei weitem nicht abgeschlossen; und es gilt zu bezweifeln, dass dies in absehbarer Zeit gelingen kann oder sollte. Es gilt, zukünftig besser zu scheitern.